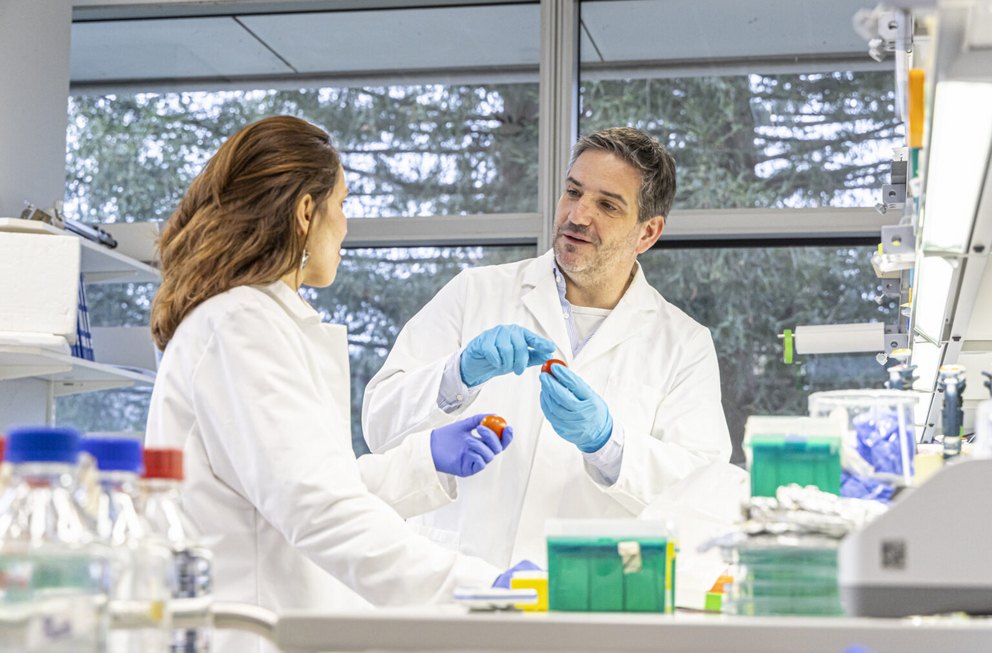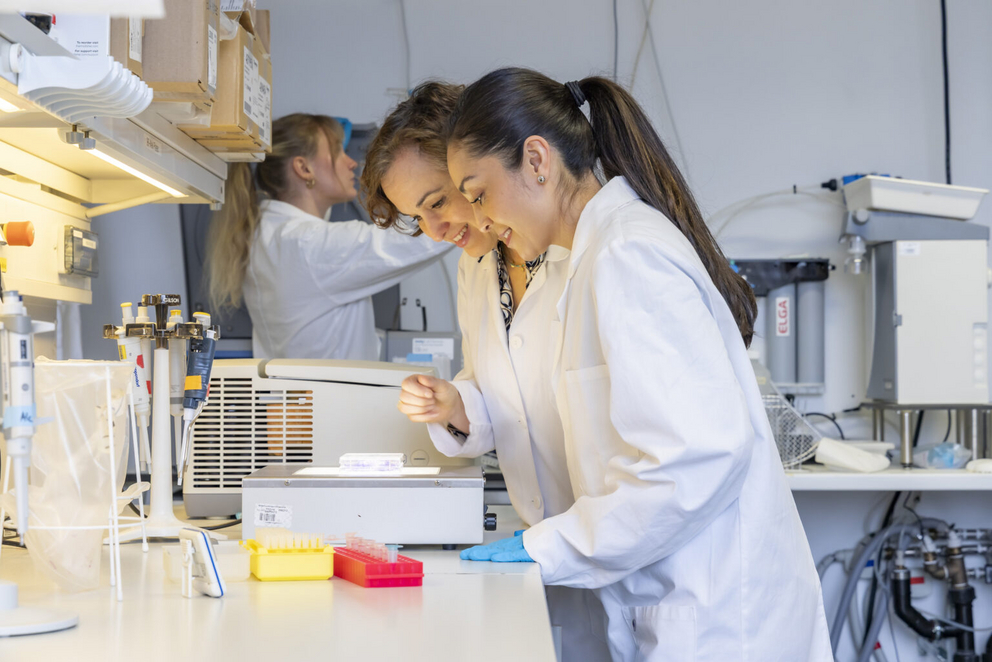Was verbindet Krankheitserreger, Pflanzen und Immunzellen?
Der Krankheitserreger Pseudomonas aeruginosa kann schwere Infektionen beim Menschen auslösen. Wie genau das Bakterium in Wirtszellen eindringt, untersucht der Zellbiologe Prof. Dr. Winfried Römer. Er konnte zeigen, dass Pseudomonas aeruginosa mithilfe bestimmter Lektine gezielt Einstülpungen der Plasmamembran auslöst, um eine Zelle zu infizieren. Diese Erkenntnis inspirierte die Arbeit des Pflanzenforschers Prof. Dr. Thomas Ott und Dr. Casandra Hernández-Reyes, Postdoktorandin bei CIBSS, die symbiotische Infektionen von Pflanzen durch Bakterien untersuchen. In Zusammenarbeit mit der Gruppe um Römer begannen Ott und sein Team, vergleichbare Mechanismen bei der so genannten Wurzelknöllchensymbiose von bestimmten Pflanzen mit nützlichen Mikroorganismen wie Rhizobien zu untersuchen.
Parallel dazu floss Römers Arbeit in ein weiteres Forschungsprojekt innerhalb von CIBSS ein: Unter gemeinsamer Leitung und in Zusammenarbeit mit CLP Fund Empfängerin Dr. Ana Valeria Melendez und Dr. Rubí Misol-Há Velasco Cárdenas untersuchten Römer und die Immunologin Prof. Dr. Susana Minguet, wie Lektine gezielt eingesetzt werden können, um Tumorzellen spezifisch zu erkennen. Beide Teams entwickelten Hand in Hand so genannte lektinbasierte chimäre Antigenrezeptoren (CAR) auf Immunzellen, die aufgrund ihres Bindungsmechanismus in der Lage sind, bestimmte Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören. Diese Arbeiten verdeutlichen, wie gemeinsame molekulare Prinzipien in völlig unterschiedlichen biologischen und medizinischen Kontexten Anwendung finden können.
Proteine mit vielseitigen Funktionen: Lektine bei bakteriellen Infektionen
Seit vielen Jahren arbeiten Römer und sein Team daran, die Mechanismen zu verstehen, mit denen Krankheitserreger die Zellmembranen ihrer Wirtszellen manipulieren, um Infektionen auszulösen. „Einer unserer Schwerpunkte liegt dabei auf der Frage, inwiefern Lektine bei bakteriellen Infektionen zelluläre Prozesse beeinflussen“, sagt Römer. In ihren ersten Studien konzentrierten sich die Forschenden speziell auf das Lektin LecA des Infektionen auslösenden Bakteriums Pseudomonas aeruginosa.
Dabei zeigten sie, dass bakterielle Lektine nicht nur eine Art Klebstoff sind, mit dem sich Bakterien an Wirtszellen anheften. LecA wirkt darüber hinaus als Invasionsfaktor, indem es gezielt an das Glykolipid Gb3 auf der Zellmembran bindet, was dazu führt, dass sich die Lipide in der Membran reorganisieren und zusammenlagern – ein Mechanismus, den die Wissenschafler*innen als „Lipid-Zipper“ beschreiben. Durch diesen Prozess werden zelluläre Signalwege aktiviert, die es dem Bakterium erleichtern, in die Wirtszelle einzudringen. Wegweisende erste Ergebnisse wurden bereits 2014 veröffentlicht – sie sind eine wichtige Grundlage für viele weitere im Rahmen des Exzellenzclusters CIBSS durchgeführte Studien.
Signalwege entschlüsseln: Neue Ansätze gegen Infektionen und Krebs
Bereits in den ersten Studien von Römers Team spielte auch das Glykolipid Gb3 eine zentrale Rolle. „Gb3 ist nicht nur ein Bindungspunkt für bakterielle Lektine, sondern war schon damals auch als Tumormarker bekannt, der auf der Oberfläche vieler Krebszellen übermäßig stark angereichert vorkommt“, sagt Römer.